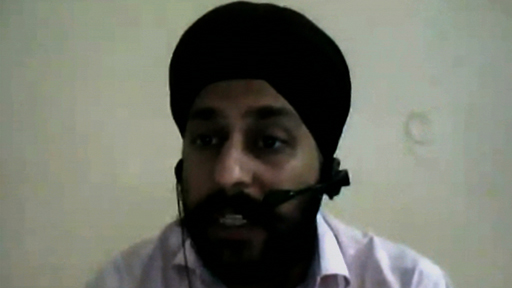Förderungen für Privatrundfunk: Keine Entscheidungen am grünen Tisch!
Im Jahr 2009 wurden in Österreich zwei neue Fonds für den privaten Rundfunk eingerichtet: Ein Fonds zur Förderung des privaten (kommerziellen) Rundfunks und ein weiterer zur Förderung des nichtkommerziellen privaten Rundfunks. In den gesetzlichen Bestimmungen war vorgesehen, dass Österreich Richtlinien für die Gestaltung, Abwicklung und Auszahlung der beiden Fonds bei der Europäischen Kommission zu notifizieren hat. Das beihilfenrechtliche Genehmigungsverfahren vor der Europäischen Kommission wurde am 27. Jänner 2010 positiv abgeschlossen.
Weiters wurde ein Fachbeirat von der österreichischen Bundesregierung bestellt. Dieser Fachbeirat besteht aus fünf Damen und Herren, die als Experten in diesem Bereich gelten. Vorsitzender des Fachbeirates ist Univ.Prof. Dr. Michael Holoubek, der auch Mitglied des Verfassungsgerichtshofes ist. Der Fachbeirat hat aufgrund der eingereichten Förderanträge Empfehlungen gegenüber der Geschäftsführung der RTR-GmbH abzugeben, welche Anträge gefördert werden sollten.
Zuständig für die Vergabe von Förderungen ist der Geschäftsführer des Fachbereiches Medien in der RTR-GmbH, der seine Entscheidungen aufgrund der Empfehlungen des Fachbeirates und nach ausgiebigen Diskussionen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trifft.
Im Jahr 2012 ist vorgesehen, dass die RTR-GmbH für den kommerziellen Rundfunk 12,5 Mio Euro und für den nichtkommerziellen Rundfunk 2,5 Mio Euro an Förderungen zu vergeben hat. Im Jahr 2013 erhöhen sich die Förderungen auf 15 Mio Euro bzw. 3 Mio Euro. Grundsätzlich werden in beiden Fonds jedenfalls 80% der Förderungen für Inhalte bzw. Projekte vergeben. Weiters ist in den Richtlinien dargelegt, dass jeweils 10% für Ausbildungsmaßnahmen bzw. für Studien vergeben werden könnte.
Uns in der RTR-GmbH ist es sehr wichtig, nicht am grünen Tisch zu entscheiden, sondern möglichst alle der Antragssteller persönlich zu kennen und vielfach auch in den Unternehmen gewesen zu sein. So haben wir bereits mehrere Bundesländer besucht. Außerdem haben wir erst vor einigen Wochen eine wissenschaftliche Studie zum Thema „Zur Qualität im Privatrundfunk“ veröffentlicht, um die Vor- und Nachteile der österreichischen privaten Hörfunk- und Fernsehveranstalter zusätzlich kennen zu lernen. Hauptverantwortlich für diese Studie war Univ.Prof. Dr. Josef Trappel, Universität Salzburg.