Diskussion mit Bertram Gugel im Anschluss seines Vortrages


Diskussion mit Bertram Gugel im Anschluss seines Vortrages

Pay Conditions in the Music and TV Industry
Sarah Baker presents the pay conditions of creative labour in two cultural industries – music recording and television production. It draws, firstly, on research she conducted with David Hesmondhalgh between 2006-7 which looked at, among other things, independent television production in the UK. This research found that conditions of pay, hours and job security are important contributors to the conceptualisation of work as ‚good‘ or ‚bad‘, especially for newcomers to TV work (Hemondhalgh & Baker 2011). She then turns to an examination of pay conditions in the Icelandic music industry, and musicians’ subjective experiences of their labour pre- and post-crash. This research, undertaken in 2010-11, reveals the precarity of music making in Iceland, where distinctions are made between ‘making it’ (critical acclaim) and ‘making a living’ (getting paid) in a market that is now viewed by some musicians as a ‘practice space’ rather than a ‘working place’.

Diskussion mit Sarah Baker im Anschluss ihres Vortrages
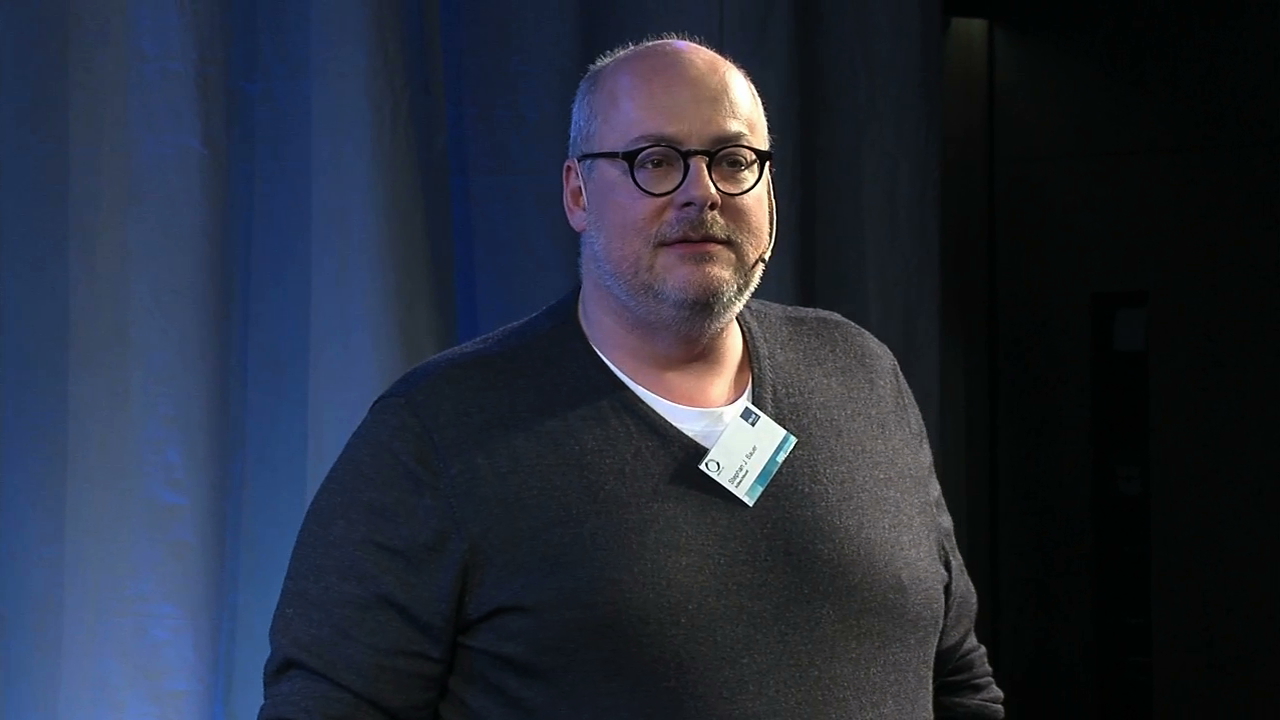
TV ist tot.
Diesmal aber wirklich. Sowas von. Echt wahr.
Seit Jahrzehnten wird das klassische Fernsehen tot gesagt, zum ersten Mal seit Jahren allerdings besteht die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines Ablebens noch in dieser Generation:
Nicht weil das TV in der Zuseher-Nutzung zum Second Screen wird, nicht weil eine junge Generation Partizipation statt Konsum wünscht, vor allem weil die, die bislang an der Entstehung von Content Teilhabe hatten, immer weniger Partizipationsmöglichkeiten sehen: die Produzenten.
Die Produzentenlandschaft verändert sich dramatisch und mit hoher Geschwindigkeit hin zu „Nischen“ immer häufiger auch außerhalb des TV.
Damit werden diese Nischen bald keine mehr sein.

Susanne Lüchtrath stellte das Format „Heute im Osten“ vor, das für den MDR entwickelt wurde und seit April 2013 on air und auch im Web zu sehen ist. Das Format funktioniert trimedial, das heißt es ist eine Sendung die im Web,TV und auch im Hörfunk stattfindet. Die Basis des Formates stellt ein historisches Onlineportal dar, das sich mit der Geschichte Mitteldeutschlands von 1945 bis heute beschäftigt. Das Format sollte eine Brücke schlagen zwischen dem „Gestern“ und „Heute“ und interaktiv sein. Die große Herausforderung war, etwas zu produzieren, das für Web und TV funktioniert. Das Konzept durfte die Alten nicht verschrecken und gleichzeitig sollten sich die Jungen angesprochen fühlen. Für das virtuelle Studio wurde ein riesengroßes Touchpad entwickelt, mit dem die Moderatorin der Sendung interagiert, und das als haptischer Communicator fungiert.

Diskussion zum Thema „Produktion zwischen Digitalisierungszeche, Nischen TV und Neuerfindung des Fernsehens“
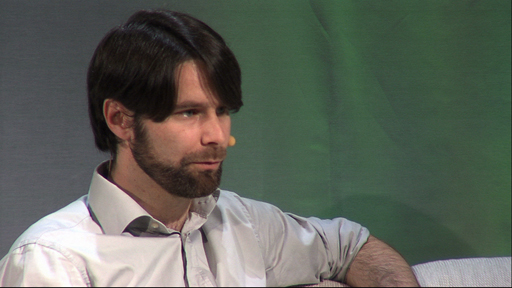
Die „Digital Natives“, also jenes Publikum, das ins Internetzeitalter hinein geboren wurde, beschäftigen die Mediennutzungforschung bereits seit Jahrzehnten. – Nicht nur, weil man jungen Zielgruppen generell eine größere Adaptionsbereitschaft technischer Innovationen im Alltag zuschreibt als früheren Kohorten. Ebenso lässt eine durch das Internet geprägte Mediensozialisation entscheidenden Einfluss auf die individuelle Bewertung journalistischen Contents angesichts kaum mehr überschaubarer Alternativen vermuten (Gratis-Content). Nicht zuletzt eröffnet die digitale Vernetzung neben neuen Rezeptionskanälen auch neue kommunikative Räume (Web 2.0 und die Folgen).
Auf Basis der durchgeführten Untersuchungen kann bestätigt werden, dass sich das Nachrichtennutzungsverhalten der nachkommenden Leserschaft sukzessive ändert. Die Nutzung ist stärker anlass- und themengetrieben und weniger durch habituelle / ritualisierte Muster geprägt. Die Fülle an Information wird von weniger technikaffinen Nutzern als Belastung wahrgenommen, was zu schärferer Selektionsleistung und Verengung des Interessenspektrums führt, sowie den Nutzwertanspruch an Information steigen lässt. Gleichzeitig steigt durch die Fragmentierung der Nutzungsmuster die Segmentierung der Nutzergruppen selbst, was es schwieriger macht die einzelnen Zielgruppen zu erreichen und zufrieden stellend mit Information zu versorgen. Darin ist auch ein wesentlicher Treiber für den Trend zum Selbstservice zu erkennen, der es besonders aktiven Nutzern ermöglicht ihre Informationsbedarfe zu befriedigen.

Seit August 2010 bietet das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ein trimediales Kinderprogramm unter dem Namen „Zambo“ an. Produziert werden Sendungen im TV, im Radio und diverse Publikationen im Internet unter www.zambo.ch. Zambo ist das erste, voll trimediale und konvergente Produkt von SRF.
Was waren die grössten Herausforderungen bei der Projektierung und Umsetzung des Projektes Zambo? Weshalb wurden ausgerechnet die Kinderprogramme auf eine trimediale Arbeitsweise ausgerichtet? Welche rechtlichen Hürden mussten für dieses Projekt überwunden werden? Was bedeute trimediales Arbeiten für die etablierten Workflows in Redaktion und in der Technik?

Förderungen für Privatrundfunk: Keine Entscheidungen am grünen Tisch!
Im Jahr 2009 wurden in Österreich zwei neue Fonds für den privaten Rundfunk eingerichtet: Ein Fonds zur Förderung des privaten (kommerziellen) Rundfunks und ein weiterer zur Förderung des nichtkommerziellen privaten Rundfunks. In den gesetzlichen Bestimmungen war vorgesehen, dass Österreich Richtlinien für die Gestaltung, Abwicklung und Auszahlung der beiden Fonds bei der Europäischen Kommission zu notifizieren hat. Das beihilfenrechtliche Genehmigungsverfahren vor der Europäischen Kommission wurde am 27. Jänner 2010 positiv abgeschlossen.
Weiters wurde ein Fachbeirat von der österreichischen Bundesregierung bestellt. Dieser Fachbeirat besteht aus fünf Damen und Herren, die als Experten in diesem Bereich gelten. Vorsitzender des Fachbeirates ist Univ.Prof. Dr. Michael Holoubek, der auch Mitglied des Verfassungsgerichtshofes ist. Der Fachbeirat hat aufgrund der eingereichten Förderanträge Empfehlungen gegenüber der Geschäftsführung der RTR-GmbH abzugeben, welche Anträge gefördert werden sollten.
Zuständig für die Vergabe von Förderungen ist der Geschäftsführer des Fachbereiches Medien in der RTR-GmbH, der seine Entscheidungen aufgrund der Empfehlungen des Fachbeirates und nach ausgiebigen Diskussionen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trifft.
Im Jahr 2012 ist vorgesehen, dass die RTR-GmbH für den kommerziellen Rundfunk 12,5 Mio Euro und für den nichtkommerziellen Rundfunk 2,5 Mio Euro an Förderungen zu vergeben hat. Im Jahr 2013 erhöhen sich die Förderungen auf 15 Mio Euro bzw. 3 Mio Euro. Grundsätzlich werden in beiden Fonds jedenfalls 80% der Förderungen für Inhalte bzw. Projekte vergeben. Weiters ist in den Richtlinien dargelegt, dass jeweils 10% für Ausbildungsmaßnahmen bzw. für Studien vergeben werden könnte.
Uns in der RTR-GmbH ist es sehr wichtig, nicht am grünen Tisch zu entscheiden, sondern möglichst alle der Antragssteller persönlich zu kennen und vielfach auch in den Unternehmen gewesen zu sein. So haben wir bereits mehrere Bundesländer besucht. Außerdem haben wir erst vor einigen Wochen eine wissenschaftliche Studie zum Thema „Zur Qualität im Privatrundfunk“ veröffentlicht, um die Vor- und Nachteile der österreichischen privaten Hörfunk- und Fernsehveranstalter zusätzlich kennen zu lernen. Hauptverantwortlich für diese Studie war Univ.Prof. Dr. Josef Trappel, Universität Salzburg.

Alfred Grinschgl im Diskurs mit Gastgeberin Rosa von Suess und dem Publikum.